
BingX KI-Revolution: Wie Künstliche Intelligenz das Trading für immer verändert
30.08.2025
BingX KI-Revolution: Ein Klick analysiert Charts, erkennt Support/Resistance & liefert Trading-Signale! ✅ 20% Rabatt + 11.500$ Bonus ✅ Jetzt testen!

Andi Lehner
29. August 2025, 14:45 Uhr
Die Finanzwelt steht vor einer historischen Entscheidung: Die Europäische Zentralbank (EZB) erwägt ernsthaft, den digitalen Euro auf öffentlichen Blockchains wie Ethereum oder Solana zu lancieren. Was ursprünglich als geschlossenes, zentral verwaltetes System geplant war, könnte zu einer der größten Krypto-Revolutionen in der Geschichte Europas werden.
Diese Kehrtwende kommt nicht von ungefähr. Nachdem die USA im Juli 2025 ihr erstes Stablecoin-Gesetz verabschiedeten und damit Dollar-basierten Token einen Vorsprung in der globalen Finanzwelt verschafften, sieht sich Europa unter Zugzwang. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie schnell Europa reagieren muss, um seine monetäre Souveränität zu bewahren.
Die ersten Gerüchte über eine mögliche Blockchain-Implementierung des digitalen Euro kamen Ende August 2025 auf, als die Financial Times berichtete, dass EU-Beamte öffentliche Blockchains in Betracht ziehen. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse.
Bestätigt:
• EZB erwägt öffentliche Blockchains für digitalen Euro
• Ethereum und Solana werden konkret diskutiert
• Start frühestens 2028 geplant
• 70 private Partner bereits in Innovation Platform eingebunden
Spekulationen:
• Mögliche Hybrid-Lösung aus privater und öffentlicher Blockchain
• Integration in bestehende DeFi-Protokolle
• Direkte Konkurrenz zu US-Stablecoins
• Potenzielle Kooperation mit großen Krypto-Börsen
Ram Kumar, ein Kernentwickler bei der Blockchain-Infrastrukturfirma OpenLedger, bringt es auf den Punkt: "Die Einführung des Euro auf einer öffentlichen Blockchain würde seine Reichweite dramatisch erweitern. Er könnte sofort in die breitere Krypto-Ökonomie eingebunden werden."
Diese Aussage ist mehr als nur Spekulation. Sie zeigt, welche enormen Möglichkeiten sich auftun, wenn Europa den Mut fasst, traditionelle Finanzstrukturen zu durchbrechen. Ein digitaler Euro auf Ethereum oder Solana würde nicht nur technische Grenzen überwinden, sondern könnte Europa zum Vorreiter einer neuen digitalen Weltordnung machen.
Die Dringlichkeit wird durch die geopolitische Lage verstärkt. Das US-amerikanische GENIUS Act hat Dollar-basierten Stablecoins einen regulatorischen Vorsprung verschafft, der die globale Finanzarchitektur zugunsten der USA verschieben könnte. Europa steht vor der Wahl: Entweder es reagiert schnell und entschlossen, oder es läuft Gefahr, in der digitalen Währungsrevolution ins Hintertreffen zu geraten.
Die Wahl der Blockchain-Plattform ist entscheidend für den Erfolg des digitalen Euro. Beide Kandidaten bringen einzigartige Vorteile mit sich, die Europa in verschiedene Richtungen führen könnten. Diese Entscheidung wird nicht nur technische Auswirkungen haben, sondern auch bestimmen, wie sich der digitale Euro in das globale Krypto-Ökosystem integriert.
Ethereum gilt als das "Internet des Geldes" und bietet eine ausgereifte Infrastruktur, die bereits Billionen von Dollar verwaltet. Für den digitalen Euro würde Ethereum folgende Vorteile bieten:
Programmierbarkeit und Entwickler-Ökosystem: Mit über 4.000 dezentralen Anwendungen (dApps) und einer riesigen Entwicklergemeinschaft könnte der digitale Euro sofort in bestehende DeFi-Protokolle integriert werden. Smart Contracts würden automatisierte Zahlungen, Kredite und komplexe Finanzinstrumente ermöglichen. Stellen Sie sich vor: Ein deutscher Mittelständler könnte seine Euro-Reserven automatisch in einem DeFi-Protokoll anlegen und dabei höhere Zinsen erzielen als bei traditionellen Banken, während das Geld jederzeit verfügbar bleibt.
Sicherheit und Dezentralisierung: Ethereum wird von über 900.000 Validatoren gesichert und hat seit seinem Start 2015 nie einen größeren Sicherheitsvorfall erlebt. Diese Robustheit wäre für eine europäische Zentralbankwährung von unschätzbarem Wert. Die dezentrale Natur des Netzwerks bedeutet, dass kein einzelner Akteur das System kontrollieren oder manipulieren kann.
Interoperabilität: Ethereum ist mit zahlreichen anderen Blockchains verbunden und würde dem digitalen Euro Zugang zu einem globalen Netzwerk von Finanzdienstleistungen verschaffen. Cross-Chain-Bridges ermöglichen bereits heute den nahtlosen Transfer von Werten zwischen verschiedenen Blockchain-Ökosystemen.
Solana positioniert sich als die "Visa der Blockchains" und könnte für den digitalen Euro entscheidende Vorteile bieten:
Geschwindigkeit und Skalierbarkeit: Mit über 65.000 Transaktionen pro Sekunde und Bestätigungszeiten von unter einer Sekunde könnte Solana den digitalen Euro für Alltagszahlungen optimieren. Ein Kaffee in Berlin könnte genauso schnell bezahlt werden wie eine Überweisung nach Madrid. Diese Geschwindigkeit ist entscheidend für die Massenadoption einer digitalen Währung.
Niedrige Kosten: Transaktionsgebühren von weniger als 0,01 Dollar machen Mikrozahlungen erst möglich. Dies könnte neue Geschäftsmodelle und Anwendungsfälle für den digitalen Euro eröffnen. Content Creator könnten Mikrozahlungen für ihre Inhalte erhalten, ohne dass hohe Gebühren die Rentabilität zunichte machen.
Mobile-First Ansatz: Solana wurde von Grund auf für mobile Anwendungen entwickelt und könnte den digitalen Euro zur ersten wirklich mobilen Zentralbankwährung machen. Mit dem Saga-Smartphone hat Solana bereits gezeigt, wie Blockchain-Technologie nahtlos in mobile Geräte integriert werden kann.
Die Entscheidung für eine öffentliche Blockchain würde dem digitalen Euro Superkräfte verleihen, die mit traditionellen Zahlungssystemen unmöglich wären. Diese Vorteile gehen weit über technische Verbesserungen hinaus und könnten die Art und Weise revolutionieren, wie wir über Geld und Zahlungen denken.
Ein digitaler Euro auf Ethereum oder Solana wäre nicht nur in Europa verfügbar, sondern könnte sofort weltweit genutzt werden. Jeder mit einer Krypto-Wallet könnte europäische Währung halten und verwenden, ohne ein traditionelles Bankkonto zu benötigen. Dies ist besonders relevant für die 1,4 Milliarden Menschen weltweit, die keinen Zugang zu Bankdienstleistungen haben.
Der digitale Euro könnte zur ersten wirklich inklusiven Währung werden und Europa als Vorreiter für finanzielle Inklusion positionieren. Ein Kleinbauer in Afrika könnte direkt Zahlungen von europäischen Importeuren erhalten, ohne auf teure Überweisungsdienste angewiesen zu sein. Die Transaktionskosten würden von durchschnittlich 7% bei traditionellen Überweisungen auf unter 1% sinken.
Decentralized Finance (DeFi) verwaltet bereits über 100 Milliarden Dollar und wächst exponentiell. Ein digitaler Euro auf einer öffentlichen Blockchain könnte sofort in Lending-Protokolle, Yield Farming, automatisierte Market Maker und andere innovative Finanzinstrumente integriert werden.
Die Möglichkeiten sind endlos: Automatisierte Sparpläne, die sich je nach Marktbedingungen anpassen. Versicherungen, die sich selbst abwickeln, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Kredite, die ohne menschliche Intervention vergeben und zurückgezahlt werden. All dies wäre mit einem programmierbaren digitalen Euro möglich.
Smart Contracts würden völlig neue Anwendungsfälle ermöglichen. Gehälter könnten automatisch ausgezahlt werden, Versicherungen könnten sich selbst abwickeln, und Lieferketten könnten sich automatisch finanzieren. Die Effizienzgewinne wären enorm.
Ein praktisches Beispiel: Ein Solarpark in Spanien könnte programmiert werden, automatisch Strom-Token zu verkaufen und die Erlöse in digitalen Euro zu erhalten, sobald eine bestimmte Energiemenge produziert wurde. Alles ohne menschliche Intervention oder traditionelle Banken. Die Transparenz der Blockchain würde dabei sicherstellen, dass alle Transaktionen nachverfolgbar und verifizierbar sind.
Grenzüberschreitende Zahlungen, die heute Tage dauern und hohe Gebühren kosten, könnten in Sekunden und für Bruchteile eines Cents abgewickelt werden. Dies würde den internationalen Handel revolutionieren und besonders kleineren Unternehmen neue Märkte erschließen.
Ein italienischer Olivenölproduzent könnte seine Produkte direkt an einen japanischen Importeur verkaufen, ohne Banken, Wechselkurse oder Verzögerungen. Die Zahlung würde automatisch erfolgen, sobald die Lieferung per IoT-Sensoren bestätigt wird. Smart Contracts könnten sogar Qualitätskontrollen und Versicherungen automatisch abwickeln.
Programmierbare Währungen ermöglichen völlig neue Geschäftsmodelle. Mikrozahlungen für digitale Inhalte, automatisierte Lizenzgebühren für Künstler, oder selbstausführende Verträge für Freelancer würden alltäglich werden.
Die Creator Economy könnte besonders profitieren. Ein deutscher YouTuber könnte automatisch Mikrozahlungen von Zuschauern aus aller Welt erhalten, ohne sich um Währungsumrechnungen oder Zahlungsdienstleister kümmern zu müssen. Künstler könnten ihre Werke tokenisieren und automatisch Lizenzgebühren erhalten, wann immer ihre Kunst verwendet wird.
Trotz aller Vorteile gibt es berechtigte Bedenken, die Europa nicht ignorieren kann. Diese Risiken sind real und könnten, wenn sie nicht sorgfältig adressiert werden, zu ernsthaften Problemen für die europäische Finanzstabilität und die Rechte der Bürger führen.
Die größte Herausforderung ist die Vereinbarkeit mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (GDPR). Öffentliche Blockchains sind per Definition transparent und unveränderlich - zwei Eigenschaften, die mit dem "Recht auf Vergessenwerden" kollidieren.
Jede Transaktion wäre theoretisch für immer sichtbar und nachverfolgbar. Dies steht im direkten Widerspruch zu den Datenschutzrechten europäischer Bürger und könnte zu rechtlichen Problemen führen. Während die EZB betont, dass sie "cash-like anonymity" anstrebt, ist unklar, wie dies auf einer öffentlichen Blockchain technisch umsetzbar wäre.
Mögliche Lösungsansätze wie Zero-Knowledge-Proofs oder Privacy-Coins sind noch nicht ausgereift genug für eine Zentralbankwährung. Die Gefahr besteht, dass der digitale Euro entweder die Privatsphäre der Bürger verletzt oder technisch so komplex wird, dass er nicht massentauglich ist.
Weder Ethereum noch Solana stehen unter direkter staatlicher Kontrolle. Updates, Governance-Entscheidungen und technische Änderungen würden von dezentralen Gemeinschaften getroffen, nicht von europäischen Behörden.
Dies könnte zu Situationen führen, in denen Europa technisch von Entscheidungen abhängig ist, die außerhalb seiner Kontrolle liegen. Ein Blockchain-Update könnte theoretisch die Funktionsweise des digitalen Euro beeinträchtigen, ohne dass Europa direkten Einfluss hätte. Bei Ethereum beispielsweise werden wichtige Entscheidungen von der Ethereum Foundation und Core-Entwicklern getroffen, die hauptsächlich in den USA ansässig sind.
Solana hat zusätzlich das Problem gelegentlicher Netzwerkausfälle. In den letzten Jahren gab es mehrere Situationen, in denen das Netzwerk für Stunden oder sogar Tage nicht verfügbar war. Für eine Zentralbankwährung wäre dies inakzeptabel.
Ein leicht zugänglicher digitaler Euro könnte zu massiven Kapitalabflüssen aus traditionellen Banken führen. Wenn Bürger ihre Einlagen einfach in digitale Euro umwandeln könnten, würde dies das traditionelle Bankensystem destabilisieren.
Piero Cipollone, Mitglied des EZB-Direktoriums, warnte bereits im April 2025, dass US-Stablecoins Einlagen von europäischen Banken abziehen und die Rolle des Dollars stärken könnten. Ein schlecht implementierter digitaler Euro könnte ähnliche Probleme verursachen, nur dass diesmal europäische Banken betroffen wären.
Die EZB müsste sorgfältige Limits und Anreizstrukturen entwickeln, um zu verhindern, dass der digitale Euro das traditionelle Bankensystem untergräbt. Dies könnte jedoch die Attraktivität und Nützlichkeit der digitalen Währung einschränken.
Beide Blockchain-Plattformen haben ihre eigenen Skalierungsprobleme. Ethereum kann derzeit nur etwa 15 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, was für eine europäische Zentralbankwährung völlig unzureichend wäre. Zwar gibt es Layer-2-Lösungen, aber diese fügen zusätzliche Komplexität hinzu.
Solana kann zwar theoretisch 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, aber diese Zahlen wurden unter Laborbedingungen erreicht. In der Realität ist das Netzwerk bereits bei deutlich geringerer Last an seine Grenzen gestoßen. Für eine Währung, die von 450 Millionen Europäern genutzt werden könnte, wären diese Limitierungen problematisch.
Datenschutz-Risiken:
• GDPR-Konformität fraglich
• Transparenz vs. Privatsphäre-Konflikt
• Unveränderlichkeit der Blockchain
• Schwierige Umsetzung von "cash-like anonymity"
Technische Risiken:
• Abhängigkeit von externen Entwicklern
• Skalierungsprobleme bei Ethereum
• Ausfallrisiken bei Solana
• Governance außerhalb staatlicher Kontrolle
Finanzstabilitäts-Risiken:
• Mögliche Bank-Runs
• Destabilisierung des Bankensystems
• Unkontrollierte Kapitalflüsse
• Schwierige Balance zwischen Innovation und Stabilität
Die Entscheidung Europas könnte weitreichende Konsequenzen für die globale Finanzordnung haben. Ein digitaler Euro auf einer öffentlichen Blockchain wäre mehr als nur eine technische Innovation - er könnte die geopolitischen Machtverhältnisse neu definieren und eine neue Ära der digitalen Währungen einläuten.
Ein digitaler Euro auf einer öffentlichen Blockchain würde Europa im Kampf um die digitale Währungshegemonie gegen die USA und China positionieren. Während China seinen digitalen Yuan streng kontrolliert und die USA auf private Stablecoins setzen, könnte Europa mit einem offenen, programmierbaren Euro einen dritten Weg einschlagen.
Dies könnte besonders für Entwicklungsländer attraktiv sein, die eine Alternative zum Dollar suchen, aber nicht von China abhängig werden wollen. Der digitale Euro könnte zur bevorzugten Reservewährung für eine neue Generation digitaler Volkswirtschaften werden. Länder in Afrika, Lateinamerika und Südostasien könnten den digitalen Euro als neutrale Alternative zu den Währungen der Supermächte betrachten.
Die strategischen Implikationen sind enorm. Europa könnte seine soft power erheblich stärken und gleichzeitig seine wirtschaftliche Unabhängigkeit von den USA und China vergrößern. Ein erfolgreicher digitaler Euro könnte auch andere Zentralbanken dazu ermutigen, ähnliche Wege zu gehen, was zu einer multipolaren digitalen Währungslandschaft führen würde.
Die Auswirkungen auf den internationalen Zahlungsverkehr wären revolutionär. Das derzeitige SWIFT-System, das täglich über 150 Millionen Nachrichten verarbeitet, könnte obsolet werden. Grenzüberschreitende Zahlungen, die heute Tage dauern und hohe Gebühren kosten, könnten in Sekunden und für Bruchteile eines Cents abgewickelt werden.
Dies würde besonders kleineren Unternehmen und Entwicklungsländern zugutekommen. Ein Kaffeebauer in Kolumbien könnte direkt an einen Röster in Deutschland verkaufen, ohne auf teure Zwischenhändler oder Banken angewiesen zu sein. Die Demokratisierung des internationalen Handels könnte zu einer gerechteren Verteilung der Handelsgewinne führen.
Traditionelle Banken müssten sich grundlegend neu erfinden. Viele ihrer derzeitigen Dienstleistungen - Überweisungen, Währungsumtausch, Zahlungsabwicklung - könnten durch Smart Contracts automatisiert werden. Dies könnte zu einer Konsolidierung der Branche führen, bei der nur die innovativsten und anpassungsfähigsten Institute überleben.
Gleichzeitig könnten völlig neue Arten von Finanzdienstleistern entstehen. DeFi-Protokolle könnten zu ernsthaften Konkurrenten traditioneller Banken werden. Neue Berufsfelder wie "DeFi-Berater" oder "Smart Contract-Auditoren" könnten entstehen.
Die EZB müsste ihre geldpolitischen Instrumente grundlegend überdenken. Mit einem programmierbaren digitalen Euro könnten geldpolitische Maßnahmen viel präziser und schneller umgesetzt werden. Negative Zinsen könnten direkt in die Währung programmiert werden, Konjunkturpakete könnten automatisch an bestimmte Bedingungen geknüpft werden.
Dies könnte zu einer effektiveren Geldpolitik führen, aber auch neue Risiken schaffen. Die Versuchung, die Programmierbarkeit für politische Zwecke zu missbrauchen, wäre groß. Datenschutz und finanzielle Privatsphäre könnten unter dem Vorwand der Geldpolitik weiter eingeschränkt werden.
Ein digitaler Euro auf einer öffentlichen Blockchain könnte einen Innovationsschub auslösen, der mit der Einführung des Internets vergleichbar ist. Neue Geschäftsmodelle, die heute undenkbar sind, könnten entstehen.
Mikrozahlungen könnten alltäglich werden und völlig neue Märkte schaffen. Content Creator könnten pro Sekunde bezahlt werden, IoT-Geräte könnten automatisch für ihre Dienste bezahlen, und KI-Systeme könnten eigenständig wirtschaftliche Transaktionen durchführen.
Die Tokenisierung von Vermögenswerten könnte explodieren. Immobilien, Kunstwerke, Patente - alles könnte in handelbare Token umgewandelt werden. Dies könnte zu einer Demokratisierung des Investierens führen, bei der auch kleine Anleger Zugang zu bisher exklusiven Anlageklassen erhalten.
Die Regulierungsbehörden stünden vor enormen Herausforderungen. Wie überwacht man Transaktionen auf einer öffentlichen Blockchain? Wie verhindert man Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung? Wie schützt man Verbraucher vor Betrug und Manipulation?
Neue regulatorische Frameworks müssten entwickelt werden, die Innovation fördern, aber gleichzeitig Schutz bieten. Dies könnte zu einer Fragmentierung der globalen Finanzregulierung führen, da verschiedene Länder unterschiedliche Ansätze verfolgen.
Die EZB hat bereits einen groben Zeitplan skizziert, auch wenn die finale Blockchain-Entscheidung noch aussteht. Die Entwicklung einer digitalen Zentralbankwährung ist ein komplexer Prozess, der technische, rechtliche und politische Hürden überwinden muss.
2023-2025: Vorbereitungsphase Die EZB arbeitet intensiv mit 70 privaten Partnern an der technischen Grundlage. Prototypen werden getestet und verschiedene Technologien evaluiert. Diese Phase ist entscheidend, um die Machbarkeit verschiedener Ansätze zu bewerten und potenzielle Probleme frühzeitig zu identifizieren.
2025-2027: Entscheidungsphase Die finale Entscheidung über die Technologie-Plattform soll bis Ende 2026 fallen. Parallel laufen Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament und Rat über die rechtlichen Grundlagen. Diese Phase wird von intensiven politischen Diskussionen geprägt sein, da die Entscheidung weitreichende Konsequenzen für Europas digitale Zukunft haben wird.
2028: Möglicher Start Frühestens 2028 könnte der digitale Euro eingeführt werden - vorausgesetzt, alle rechtlichen und technischen Hürden werden überwunden. Selbst dann würde es sich wahrscheinlich um einen schrittweisen Rollout handeln, der zunächst auf bestimmte Anwendungsfälle oder Regionen beschränkt ist.
2025: Blockchain-Evaluierung intensiviert, Gerüchte über Ethereum/Solana
2026: Finale Technologie-Entscheidung, rechtliche Grundlagen
2027: Pilotprojekte und ausführliche Tests
2028: Möglicher Launch mit schrittweisem Rollout
Die Unsicherheit über den genauen Zeitplan spiegelt die Komplexität des Projekts wider. Jede Verzögerung könnte Europa im globalen Wettlauf um digitale Währungen zurückwerfen, aber eine übereilte Einführung könnte zu katastrophalen Fehlern führen.
Die Entscheidung über den digitalen Euro ist mehr als nur eine technische Frage - sie wird Europas Rolle in der digitalen Zukunft definieren. Ein Euro auf Ethereum oder Solana würde Europa zum Vorreiter für offene, programmierbare Währungen machen und könnte die globale Finanzordnung neu gestalten.
Die Vorteile sind verlockend: Sofortige globale Reichweite, Integration in das boomende DeFi-Ökosystem, programmierbare Zahlungen und die Möglichkeit, völlig neue Geschäftsmodelle zu schaffen. Europa könnte sich als digitale Supermacht positionieren und eine Alternative zu den geschlossenen Systemen Chinas und den privatwirtschaftlich dominierten Lösungen der USA bieten.
Doch die Risiken sind real und dürfen nicht unterschätzt werden. Datenschutz, technische Abhängigkeiten und Finanzstabilität sind berechtigte Sorgen, die sorgfältig adressiert werden müssen. Ein Fehler bei der Implementierung könnte nicht nur das Vertrauen in den digitalen Euro zerstören, sondern auch Europas Glaubwürdigkeit als Finanzstandort beschädigen.
Die Kosten des Nichtstuns könnten jedoch noch höher sein. Während die USA mit Stablecoins voranpreschen und China seinen digitalen Yuan ausrollt, läuft Europa Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Die Dominanz des Dollars im digitalen Zeitalter zu akzeptieren, würde Europas monetäre Souveränität langfristig untergraben.
Die nächsten Monate werden entscheidend sein. Europa steht vor der Wahl: Mut zur Innovation oder Verharren im Status quo. Die Entscheidung wird nicht nur die Zukunft des Euro bestimmen, sondern auch Europas Platz in der digitalen Weltordnung.
Ram Kumars Worte klingen prophetisch: "Wenn der Dollar einen Vorsprung bei digitalen Zahlungen bekommt, riskiert er, den Euro in der globalen Finanzwelt zu überschatten." Europa hat noch die Chance, dieses Szenario zu verhindern - aber das Zeitfenster schließt sich schnell.
Eines ist sicher: Die Finanzwelt wird nie wieder dieselbe sein. Die Frage ist nur, ob Europa diese Revolution anführen oder ihr hinterherlaufen wird. Die Entscheidung für oder gegen eine öffentliche Blockchain könnte den Unterschied zwischen digitaler Führerschaft und digitaler Abhängigkeit bedeuten.
Die Würfel sind noch nicht gefallen, aber sie rollen bereits. Europa muss sich entscheiden - und zwar schnell.
Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Kryptowährungen sind hochriskant und können zum Totalverlust führen. Die Entwicklung des digitalen Euro ist noch nicht abgeschlossen und alle Angaben basieren auf aktuell verfügbaren Informationen.

30.08.2025
BingX KI-Revolution: Ein Klick analysiert Charts, erkennt Support/Resistance & liefert Trading-Signale! ✅ 20% Rabatt + 11.500$ Bonus ✅ Jetzt testen!

16.08.2025
eToro Erfahrungen 2025: Mein ehrlicher Test nach 3 Monaten ✅ 1% Krypto-Gebühren ✅ Copy Trading ✅ Jetzt 100$ Cashback sichern! Alle Kosten & Features im Detail
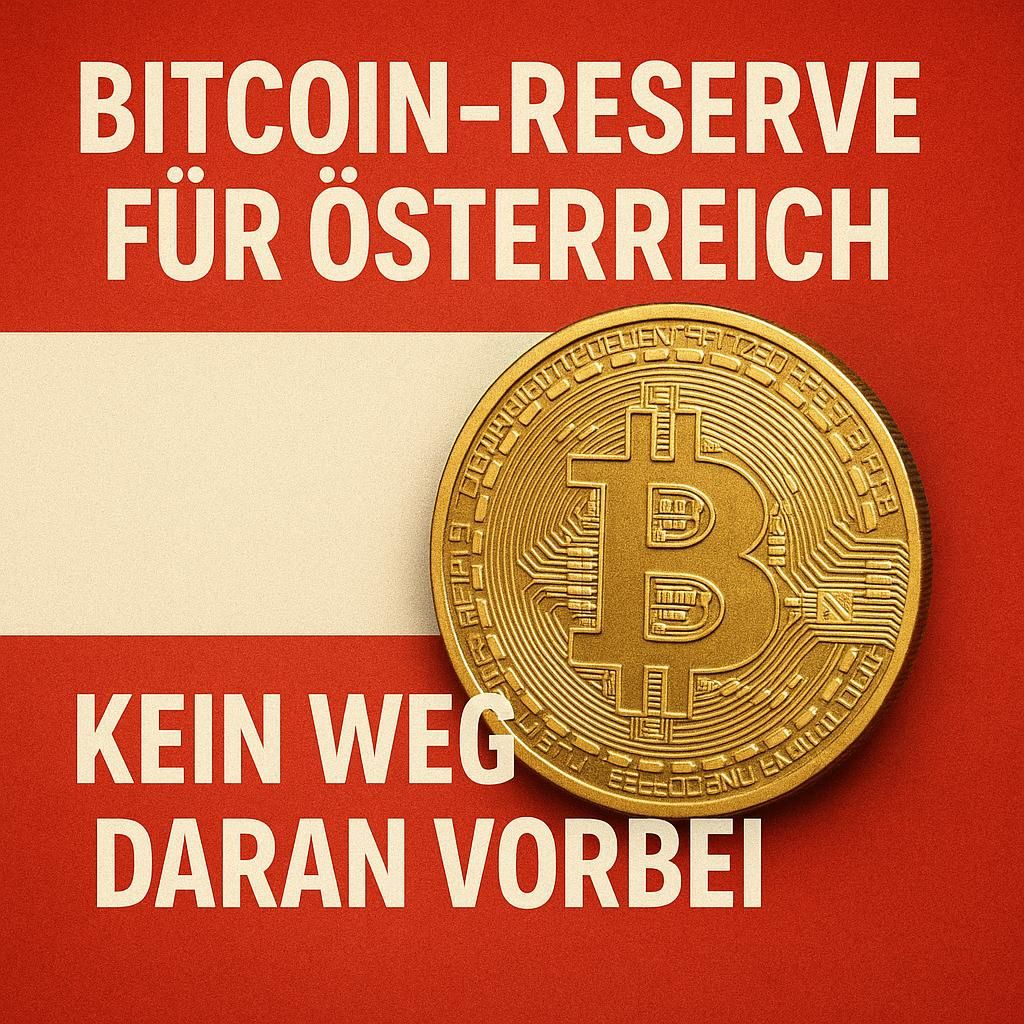
12.08.2025
Bitcoin-Reserve für Österreich ist unvermeidlich! Warum jeder mindestens 10% in Krypto investieren sollte + 10€ Gratis bei Bitvavo. Jetzt kostenfrei starten!